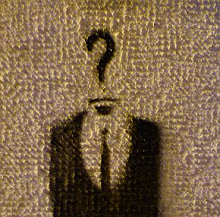Tatort: Museum der Frankfurter Eintracht
Veranstalter: Museum und FuFa
Thema: Tradition zum Anfassen: Kurvendiskussion - Die Fans der Neunziger Jahre
1990 - 1999 das sind zehn Jahre voller Höhen und Tiefen; Jahre voller Emotionen, die für viele bis heute unvergessen sind. Über Fußball 2000 nach Rostock zu Heynckes direkt in die zweite Liga und über Ehrmantraut zum Klassiker gegen Kaiserslautern, als Fjörtofts 5:1 in letzter Sekunde den Klassenerhalt 1999 bescherte - natürlich konnten nicht alle Erlebnisse an einem einzigen Abend erzählt und beleuchtet werden - aber unsere Gäste lieferten einen schönen Überblick über eine Dekade, die noch ohne Handy und Internet begonnen hatte und mit der Angst vor Systemabstürzen anlässlich der Jahreszahl 2000 endete.
Das erste Pflichtspiel der Neunziger bestritt die Eintracht am 24.02.1990 gegen den VfB Stuttgart - und sie siegte mit 5:1; das letzte Pflichtspiel brachte am 18.12.1999 ein 0:3 beim SSV Ulm. Bei beiden Spielen hieß der Trainer Jörg Berger, der jedoch nach dem Spiel in Ulm entlassen wurde, wie zuvor schon im April 1991, als die Eintracht im Waldstadion gegen den HSV mit 0:6 unterlag.
Die Fanszene der Eintracht war zu Beginn des Jahrzehnts überschaubar; Fanclubs und Fanprojekt boten die organisatorische Plattformen und die Ende 1991 gegründete und bis heute existierende Fanzeitung Fan geht vor diente als Sprachrohr. Noch dachte niemand an Logen oder Arenen; die Heimat der altgedienten SGE Fans war der G-Block, in den Blöcken daneben verloren sich die anderen Anhänger auf den Stehplätzen oder auf der Gegentribüne. Die Haupttribüne war schon damals von VIPs besetzt. Die Zahl der Auswärtsfahrer schwankte erheblich - mal waren von Pferd handgezählte 23 Fans in Bremen, mal weit über 10.000 in Rostock. Auch die Zuschauerzahlen bei Heimspielen waren höchst unterschiedlich, ausverkauft waren stets die Spiele gegen die Bayern, ansonsten konnte man ohne Schwierigkeiten Eintrittskarten an der Tageskasse erstehen, um Stein, Bein, Falke oder Yeboah zaubern zu sehen. Man trug Kutte oder Trikot; das Merchandising wurde seitens der Eintracht sträflich vernachlässigt - allein im noch heute existierenden Fanshop in der Bethmannstraße konnten sich die Fans mit Eintrachtutensilien eindecken.
Das Fanprojekt organisierte von Zeit zu Zeit Fußballspiele und Treffen zwischen den Fans der jeweiligen Gegner - überhaupt bestimmten Fanfreundschaften das Bild. So kam es zu vielen Treffen zwischen Frankfurter und Duisburger Anhängern - aber auch mit Fans von Dynamo Dresden oder Hansa Rostock - wir erinnern uns: Die Wiedervereinigung steckte noch in den Kinderschuhen; bis vor wenigen Wochen war die DDR für uns noch Ausland gewesen. Auch Bildungsurlaube wurden vom Fanprojekt organisiert.
Fedor betonte, dass die Fanszene zu Beginn der Neunziger von einzelnen Köpfen gelebt hatte - Anjo Scheel, Pferd, Axel Gonther, Rainer Kaufmann, Thommy Kummetat um einzelne Aktivisten zu nennen. Die Adlerfront hatte den ganz großen Reiz verloren - obwohl noch immer im Stadion präsent - Fanpolitik wurde vorwiegend in Gremien gemacht, Fanvertreterversammlungen oder der Fanbeirat als wesentliche Institutionen. Eine dynamische Fanszene wie wir sie heute kennen gab es nicht, die Stimmung mit der Situation nach dem ersten Abstieg 1996 nicht vergleichbar.
Die ersten Fahnenpässe wurden eingeführt, nachdem große Fahnenstöcke zwischenzeitlich sogar verboten waren. Mit Reiner Schäfer, Geschäftsführer der Eintracht zu Beginn der 90er, hatten die aktiven Fans einen verständigen Ansprechpartner.
Während heute vielfältige Informationen jederzeit über das Internet abrufbar sind, bestand die Öffentlichkeitsarbeit mehr oder weniger aus Leserbriefen an die großen Zeitungen. Eigene Kommunikationsstrukturen funktionierten von Mund zu Mund - und erreichten natürlich nur einen Bruchteil der Fans - bis es nach dem Bockenheimer Bembel und dem Fußball-Fan-Kurier mit der Fan geht vor die in den Neunzigern dominierende Fanzeitung geben sollte.
Höhepunkte in den frühen Neunzigern waren sicherlich die Reisen nach Europa. Lodz, Moskau, Dnepropetrowsk, Ljubljana, Bukarest - erlebnisreiche Fahrten standen auf dem Programm - vor allem die Fahrt in die Ukraine blieb in nachhaltiger Erinnerung. Dnepropetrowsk, die Heimatstadt von Leonid Breschnew war ein Zentrum der Rüstungsindustrie und somit militärisches Sperrgebiet. Der Eintrachtflieger war im Zeichen von Glasnost und Perestroika die erste westliche Maschine, die dort landen durfte. Mannschaft, Journalisten und auch die Fans (genau 23 an der Zahl) - sie alle saßen im gleichen Flugzeug; Pferd hatte damals dafür gesorgt, dass auch die Fans mitfliegen durften und der erste der damals dem Flugzeug entstieg war kein Geringerer als Fanurgestein Adi Adelmann - in der Hand einen Kanister Apfelwein. Die Landung wurde live TV übertragen. Auf dem Rückflug spielten Fans und Spieler gemeinsam Karten - heute kaum vorstellbar. Als großer Vorteil erwies sich zudem, dass mit Adrian stets ein Eintrachtfan als Dolmetscher dabei gewesen ist.
In Moskau wurde über das Fanprojekt versucht, ein Treffen mit Fans zu organisieren - was daran scheiterte, dass es bei Dynamo Moskau offiziell keine Fans gab. In einer Halle kam es dann zu einem Fußballspiel zwischen Fans der Eintracht (bestehend aus Fanclubmitgliedern, Reiseveranstalter und Hools) gegen eine Moskauer Traditionsmannschaft, deren Innenverteidigung aus Altinternationalen bestand, die 1958 bei der WM gegen Pelé gespielt hatten. Nach dieser Partie (0:4) kam es zu einem Bankett. Flüssig. Die Eintracht aber sollte siegreich in Moskau bestehen. 6:0 lautete das Endresultat damals.
Für Furore sorgte die Aktion United colors of Bembeltown gegen den alltäglichen Rassismus. Initiiert von Anjo, ausgeführt von Rainer Kaufmann trug halb Frankfurt die legendären T-Shirts, die bis heute im Stadion zu sehen sind. Noch vor anderthalb Jahren ließen die Fanclubs diese Aktion erneut aufleben, sogar die Mannschaft spielte zu Beginn der Saison 2008/09 statt mit Werbeflock mit dem Slogan United Colors of Frankfurt auf der Brust. In den Neunzigern sorgte diese Aktion für großes Aufsehen, der griffige Slogan wurde gerne von den Medien aufgegriffen und die Eintrachtfans waren positiv in aller Munde. Bildlich gesprochen.
Brisant waren die Partien im Uefa-Cup gegen Galatasaray Istanbul; in Frankfurt dominierten die Fans von Galatasaray und verwandelten das Heimspiel in eine Auswärtspartie für die Eintracht. Am End brannte eine türkische Fahne im Frankfurter Block, was naturgemäß die Fans von Gala zur Weißglut brachte. In der Türkei wurden die Eintrachtler heiß empfangen, ein Auto mit einem Sarg obenauf parkte vor dem Hotel und auch die Situation im und vor dem Stadion glich einem Spießrutenlauf.
Pferd betonte, dass vor allem der Wechselgesang der Istanbuler beim Rückspiel die Eintrachtler schwer beeindruckt hatte, bislang waren solche Formen des Supports in Frankfurt gänzlich unbekannt gewesen: auch aus Lodz wurden Formen des Supports übernommen: Das Einhaken der Fans und das gesamte Hüpfen des Blocks kannten die Eintrachtfans von dort.
Wenige Monate zuvor kam es zu einem der dramatischsten aber auch traumatischsten Erlebnis in der Historie der Eintracht. Fuhr das Team und mit ihm über 10.000 Fans am letzten Spieltag als Tabellenführer nach Rostock so kehrten sie geschlagen als Dritter nach Hause zurück. Die Eintrachtler befanden sich in einem Meer der Tränen, zumal die Mannschaft noch in der Woche zuvor es nicht geschafft hatte, europapokaltrunkene Bremer im Waldstadion zu besiegen. Selbst bei einem der wichtigsten Spiele der Vereinsgeschichte war das Stadion damals nicht ausverkauft. Eine Situation, die heute undenkbar wäre.
Bis 1995 spielte die Eintracht regelmäßig international, eines der skandalösesten Spiele trug sich dabei in Wien zu, als die Eintracht dort auf Austria Salzburg traf: Es war nicht nur ein Spiel zweier Fußballmannschaften, es war ein Spiel Deutschland gegen Österreich und der Zorn der Österreicher richtete sich nicht nur gegen die Deutschen, sondern vor allem gegen Tony Yeboah, der nahezu von allen Österreichern rassistisch verhöhnt wurde. Sogar der Trainer von Salzburg, Otto Baric, fiel aus der Rolle und hatte Kachaber Zchadadse bespuckt. 2000 Frankfurter skandierten Nazis raus.
La Coruna, Napoli, Juventus - etliche Reisen brachten dolle Erinnerungen; die letzten internationalen Fahrten führten die Eintracht im UI-Cup nach Plovdiv, Vilnius und Bordeaux; ein 0:3 gegen Zidane und Co besiegelten das Ende im Wettbewerb 95/96. Zehn Jahre sollte es dauern, bis es wieder auf internationales Parkett ging.
Sechs Eintrachtler, machten sich auf nach Plovdiv, 37 waren in Vilnius dabei - Zahlen und Erlebnisse aus einer vergangenen Zeit. Letztlich waren es aber auch diese Reisen, welche die Eintrachtfans zusammen geführt haben; gemeinsame Erfahrungen von Hools und Kutten, Normalos und Fanclubmitgliedern legten den Grundstein für das, was nun folgen sollte; verbindend die Sehnsucht nach gemeinschaftlichen Erlebnissen.
Generell hatten die Eintrachtfans zur damaligen Zeit bundesweit keinen allzuguten Ruf. Wenig Stimmung, wenig Leute, kaum Kreativität, sieht man von einigen wenigen Geschichten ab; dazu das große Waldstadion, unüberdacht in den Kurven, das auch nur wenig an Stimmung zugelassen hatte.
Noch vor dem ersten Abstieg zogen die ersten Fans von der Kurve auf die Gegentribüne; zunächst vereinzelt, wurden es mit den Jahren immer mehr Fans, die unter dem Tribünendach dafür sorgten, dass es auch im Waldstadion immer lauter wurde.
Gerade die jungen Fans, die bei den älteren nur schwer Fuß fassen konnten, begannen sich in neuen Fanclubs, vorwiegend im Umland, zu organisieren. Der EFC Wiesbaden und die Bembelraver gründeten sich und wurden zunächst argwöhnisch beobachtet. Die ersten Schwenkfahnen hielten Einzug und mit ihnen zogen peu a peu die Insignien moderner Fankultur ins Waldstadion ein; Rauch und Pyro, Choreos und Support.
Binding Szene, Inferno Schwalbach, Brigade Nassau hießen neben den schon erwähnten Bembelravern und dem EFC Wiesbaden die neuen Fanclubs einer Eintracht, die ab Sommer 96 nicht mehr nach Neapel oder Moskau fuhr, sondern nach Gütersloh, Meppen und Lübeck - zu sonntäglichen Zweitliga-Partien. Dem sportlichen Niedergang folgte das erste Aufkeimen der Fanszene - und die Gründung der Ultras; der UF97.
Die alten Fanclubs standen den jungen Wilden zunächst distanziert gegenüber; Griesheim, Sossenheim, Hessen 90 fuhren zwar noch auswärts - der Jugend aber fehlte der Bezug und so begannen sie sich selbst zu organisieren. Erstaunlicherweise inspiriert von den Fans des KSC, die sich wiederum am französischen Style (Straßbourg) orientierten, wandelte sich der Begriff Stimmung zum Support.
Die Ultras waren im Grunde ein Zusammenschluss der neuen Fanclubs, deren Logistikzentrum der EFC Wiesbaden bildete. Nun fuhren etliche Busse in die Lande; über 1000 Fans wollten die Eintracht beim ersten Spiel in Lübeck begleiten. Federführend in Frankfurt war dabei Daniel Reith, dessen Wirken auch die Brücke zu den Älteren baute und der maßgeblich den Gedanken von Choreografien in die Kurve hinein trug. Zu dieser Zeit begann auch die Rivalität zu Mainz 05; einem Verein, der bis dato für die Eintrachtfans höchstens eine Rolle gespielt hatte, als dass diese selbst Spiele der Mainzer besucht hatten. Dem Nachwuchs, der Spiele gegen Offenbach nur vom Hörensagen kannte, war nun ein Gegner in unmittelbarer Nähe gegeben.
Nicht nur die Fanszene, auch die Zweite Liga gewann an Bedeutung. Neben der Eintracht war mit dem 1.FC Kaiserslautern auch ein weiteres Gründungsmitglied der Bundesliga abgestiegen; die Zuschauerzahlen schnellten in die Höhe und das Fernsehen nutzte in Form des DSF die Gelegenheit, einzelne Spiele live im TV zu zeigen. Montag abends konnten die Fans nicht nur die Eintracht sehen, sondern auch sich selbst und ihre Aktionen. Rauch und Feuerwerk, auch Choreografien wurden nun bundesweit bekannt - und zogen immer mehr Jugendliche in den Bann. Martin Stein etablierte sich als Vorsänger und gab in der Kurve den Ton vor; nicht jeder war damit einverstanden - die heutige Akzeptanz in der Kurve musste sich erkämpft werden.
Ein wesentlicher Faktor der Bewegung war der Spaßfaktor. Nicht immer wurde das Erlebnis am Ergebnis des Spiels festgemacht; ein vor allem für Ältere irritierendes Moment. Die Bewegungsfreiheit war zu diesem Zeitpunkt für alle gegeben; vom Schwimmbad- bis zum Biergartenbesuch wurden vielfältige Möglichkeiten der Freizeitgestaltung im Rahmen von Fußballspielen genutzt.
Die Ultrabewegung der Eintracht war eine Jugendbewegung mit Kern im Umland, die sich zunächst eher unpolitisch sah. Die großen Veränderungen auch im Bereich der Sicherheit, die im Wesentlichen in der WM 2006 manifestierten, lagen noch in einiger Entfernung; noch war Fußball oldschool - das Manifest der Ultras des AS Rom aber spielte in Frankfurt keine tragende Rolle. Dennoch erhielt die Gruppierung der Ultras zunächst nicht die Zulassung als Fanclub. Über diverse Umwege und Fanclubgründungen erhielten die Ultras dann doch noch vergünstigte Dauerkarten. Kai betonte, dass es ihn mit Stolz erfüllt, wenn er nun die Eintrachtkurve mit ihren Fahnen und Doppelhaltern, mit Choreos und den großen Schwenkfahnen sieht - und er daran denkt, wie klein alles angefangen hat; nicht zuletzt durch Leute wie ihn.
Brachte Rostock 1992 uns das Leiden bei, so lehrte uns der Abstieg, dass in der Not eine Kraft liegt, welche Neues gebären kann. Und wenn die Gegenwart trostlos daher kommt, besinnt man sich der Tradition, der Vergangenheit. Hatte sich bei den Verantwortlichen der Eintracht jahrelang niemand um das historische Erbe gekümmert, so brachten die Bemühungen von Leuten wie Andy Klünder oder Matthias Scheurer nicht nur die Gründungsurkunde ans Tageslicht, woraufhin das offizielle Gründungsdatum vom 1. Mai 1899 zum 8. März 1899 geändert wurde. Im Rahmen der Vorbereitungen zum 100jährigen Jubiläum fand Thomas Bauer den Wimpel zur Deutschen Meisterschaft eingestaubt nach längerer Suche in einem verbautem Schrank am Riederwald. Nicht nur bei Andy Klünder hing dieser Wimpel einige Zeit zuhause. Nun hat er seinen Platz im Museum.
Andy Klünder und Matthias Scheurer kümmerten sich nicht nur mit anderen um das Eintracht-Archiv, sondern schenkten der Eintracht auch mit Dirk Chung eine Homepage und das erste Forum. Als sich erste Erfolge einstellten und das Internet immer mehr an Bedeutung gewann, wurden mit dem Einstieg von Octagon die drei jedoch von Seiten der Eintracht ins Abseits manöveriert. Zuvor wollten die Fans aber auch bei der Eintracht Kontakte knüpfen und ihre Interessen formulieren - die Anfänge der Fan- und Förderabteilung, welche sich dann 2000 gründete, sind in dieser Zeit begründet. Als sich die Fans in den Verein begaben, verabschiedete sich der Profifußball von jenem - dies aber sind Themen der nächsten Kurvendiskussion, wenn es um die Jahre 2000 bis 2010 gehen wird.
Das Team belohnte die Fans mit dem Aufstieg 1998. Legendär wurde die erste Bundesligasaison nach dem Wiederaufstieg, als über 60.000 Zuschauer Zeuge wurden, wie Jan Aage Fjörtoft mit seinem Übersteiger der Eintracht sensationell den Klassenerhalt sicherte. Ein halbes Jahr später zierte die Eintracht abgeschlagen das Tabellenende. Für Salou, Guie-Mien, Heldt, Bulut oder Kracht wurden Millionen ausgegeben und nach der Ehrmantrautschen Bescheidenheit auf dem Gartenstuhl wurde auch dank der ISPR-Millionen wieder geklotzt und nicht gekleckert; Retter Jörg Berger wurde im Anschluss an das letzte Spiel in Ulm gefeuert und durch Felix Magath ersetzt; die Eintracht aber, deren Zukunft noch im Sommer rosig ausgesehen hatte, stand an der Schwelle zu einem neuen Jahrtausend wieder einmal am Abgrund.
Es war wie immer, die sportliche Bilanz konnte mit den Ausgaben nicht mit halten; aber eines konnte die Eintracht nun aufweisen: eine Fanszene die ihresgleichen suchte. Innerhalb weniger Jahre war aus einem mehr oder minder belächelten Haufen in Zeiten von Fußball 2000 eine der angesagtesten Szenen der Liga geworden. Und das, obwohl sich die Eintracht sportlich so desaströs zeigte, wie selten zuvor. Legendäre und typische Momente lieferte die Eintracht anlässlich des vermeintlich ausverkauften Uefa-Cup-Spiels gegen Neapel, als eine ganze Menge Eintrittskarten nach dem Spiel am Riederwald gefunden wurden oder das erste Heimspiel der Zweiten Liga gegen den FSV Zwickau, als die Eintracht nicht genügend Eintrittskarten gedruckt hatte und es zu leichten Tumulten an den Kassen kam.
So waren sie, die Neunziger - und so waren sie auch doch nicht. Jeder hat seine eigene Sichtweise auf die Zeit und es ist unmöglich jeden Sachverhalt im Detail zu durchdringen. Eines aber ist klar; die Fanszene der Eintracht hatte sich in zehn Jahren unglaublich gewandelt; wie sich auch die Inszenierung des Fußballs gewandelt hat. Wie schon angedeutet, richtete sich vieles auf die WM 2006 aus - und mit dem Aufkommen einer neuen Fankultur ging die Schwierigkeit seitens der Vereine, die immer mehr zu Unternehmen wurden, damit zu Recht zu kommen, Hand in Hand. Aber auch der DFB und die Polizei reagierten zunehmend repressiv - aus dem Fan wurde ein Sicherheitsrisiko. Dies aber wird wie so manch anderes Thema der nächsten Veranstaltung zur Fanszene sein. Die Kurvendiskussion geht weiter. Ganz sicher.
Um sich auch über Spiele und Tore der Eintracht in der damaligen Zeit einen Überblick zu verschaffen, empfehle ich euch: klickt euch durch Franks Eintracht-Archiv - das wir sicherlich auch in der nächsten Kurvendiskussion beleuchten werden.